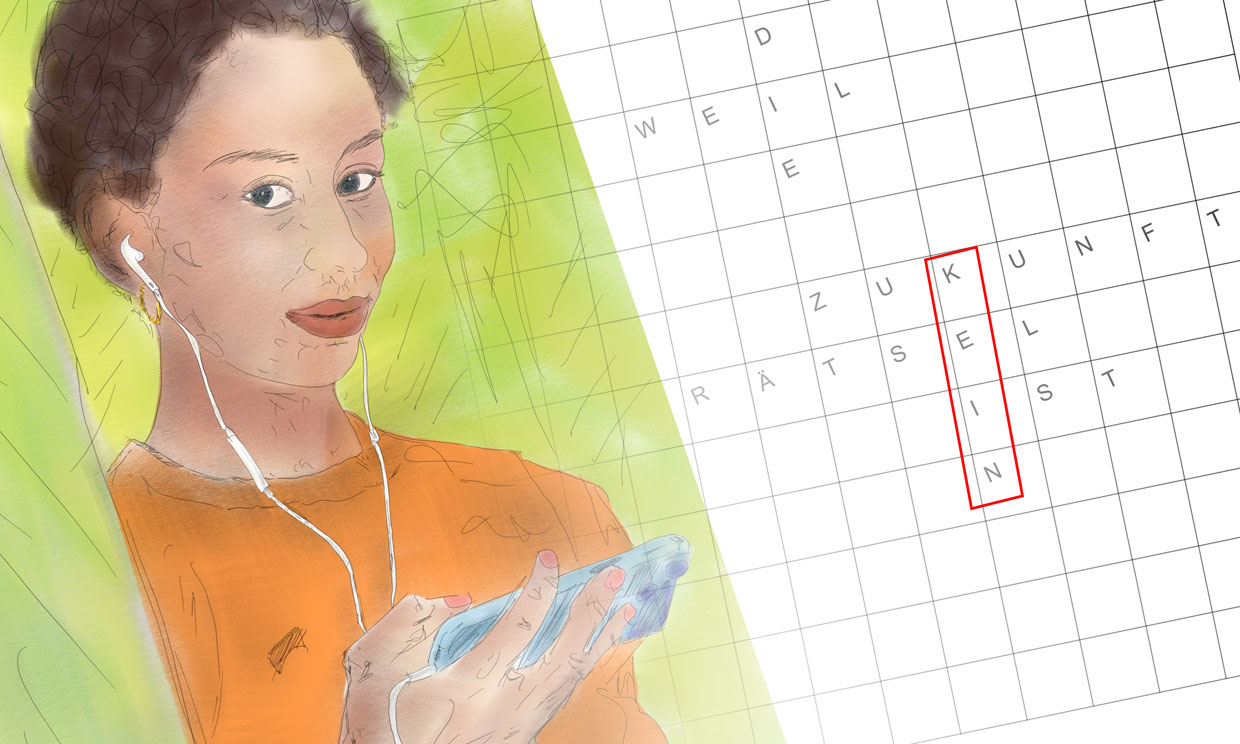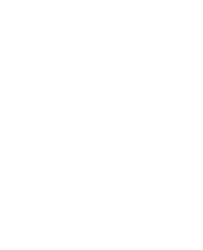… ein faszinierender Einblick in unsere Gedanken über die Zukunft von Wissen, Wissenschaft, Lebens- und Arbeitswelten.
Das war ein phantastischer Auftakt für unser futureSKILLs Projekt, der Workshop am letzten Donnerstag. Und so viele neue Ideen und Perspektiven. Wirklich außergewöhnlich. Viele Dank dafür an alle die dabei waren, bei Vorbereitung, Durchführung und Auswertung.
Was sich wirklich daraus entwickeln kann, entwickeln wird, ist noch gar nicht abschätzbar. Deshalb hier einfach einige der Gedanken, die entstanden sind, noch ganz ungefiltert und spontan in den Blogbeitrag geschrieben:
Es gibt immer mehr Wissen, das ist faszinierend, und es wird immer wichtiger zu wissen wie wir Wissen anwenden können.

In nur wenigen hundert Jahren ist ein komplexes, sich immer mehr vernetzendes System von Technologien entstanden. Die Maschinen, die wir uns konstruiert haben und die, die wir noch konstruieren werden, werden uns viel Arbeit abnehmen, das ist die Erwartung. – Dieser alte Traum der Menschheit vom Leben ohne Arbeit und Mühe. – Die körperliche Arbeit nehmen die Maschinen uns schon heute auf vielfältige Weise ab. Die geistigen Tätigkeiten vielfach auch. Und es ist deshalb immer wichtiger zu verstehen, was passiert in und mit den Systemen, die unsere technikbegabten, innovationsbegeisterten und erfindungsreichen Zeitgenossen und Vorfahren sich ausgedacht haben und ausdenken, meist mit dem Ziel das Leben zu erleichtern. Vielfach auch angetrieben von dem Drang nach Gewinn, Macht und Geltung, Motive auf die die Psychologen sehr gerne schauen und deren Auswirkungen für die sozialen Systeme in denen wir, das auf Gemeinschaft hin angelegte Sinnenwesen, leben, vor enorme Herausforderungen stellen, ganz aktuell schon und in Zukunft wohl noch immer mehr. Der Satz an Fähigkeiten und Kompetenzen, den wir brauchen, für die Welt in die wir hineinwachsen, die wir uns aus dem jetzt hin gestalten, wird also ein vielfältiger sein, weit mehr als nur ein technisch-technokratisches Wissen.
In jedem Fall öffnet die Technik, diese Klugheitswissenschaft der Anwendung von Einsichten in die Vorgefundenheit der Welt, erstaunliche Perspektiven. Ein Beispiel: Mit der Maschine, mit der ich einen Brief schreibe, eine Rechnung oder einen Roman, kann ich auch eine vollautomatische industrielle Produktionsanlage, ein Walzwerk oder eine Großbäckerei, zum Beispiel, steuern. Im Tonstudio produziere ich mit dieser Maschine Musik. Schließe ich einige dieser Maschinen in einem gut gekühlten Rack zu einem Cluster zusammen, kann ich mit ihnen einen hochaufgelösten Kinofilm rendern.
Es wird viel geschrieben und diskutiert, über future skills, aktuell, in der deutschen Bildungslandschaft. Vieles davon ist Echo der auch international geführten Diskussion. Einiges ist spezifisch für die Strukturen, wie in Deutschland Bildung und Wissenserwerb organisiert sind. Schnell sind zu den klassischen Begriffen aus dem Konzept der Schlüsselkompetenzen Schlagworte wie digital literacy und Künstliche Intelligenz hinzugekommen.
In Workshop haben wir uns die Frage gestellt, nach der Haltbarkeit dieser Begriffe und nach dem hinter ihnen liegenden Kern. Die Diskussion um autonomes Fahren ist noch gar nicht so alt und, zumindest aktuell, ganz in den Hintergrund geraten. Auf die Blockchain, als die Patentlösung für die Neugestaltung unserer Art Verträge zu machen und zu wirtschaften, hofft aktuell kaum noch jemand. Und ähnlich wie die Blockchain verbrauchen auch die gegenwärtig so gehypten KI-Systeme Unmengen an Energie und das in einer Zeit, in der wir auf sehr schmerzhafte Weise ganz direkt die Endlichkeit der von uns verbrauchten Ressourcen spüren. Da stellt sich schon die Frage, ob es sinnvoll ist, für die Erzeugung eines 800 mal 800 Pixel großen Katzenbildes den Energiebedarf einiger Einfamilienhäuser einzusetzen. Schlagworte haben in der Tat ein sehr begrenztes Haltbarkeitsdatum.
Die wissenschaftliche, die gedankliche, Methode, die hinter all diesen Entwicklungen steht, ist die Mathematik. Die Informatik, die Wissenschaft die auch die Digitalisierungsprozesse betreibt und erforscht, ist ein Teilgebiet der angewandten Mathematik und fast alles was wir tun, mit den Maschinen die wir uns gebaut haben, beruht auf dieser Art der Anwendung von Mathematik. Der Algorithmus der im Tonstudio die Störgeräusche aus der Ansage des Moderators filtert, ist dieselbe Formel, die auch das Rauschen aus meinem Handyfoto entfernt.
Im Workshop kam der Gedanke auf, das das Wissen, das wir brauchen werden und die Fähigkeit, die wir haben sollten, dieses Wissen anzuwenden, einen universellen Charakter haben werden. Ein grundlegendes Verständnis von Welt und die Fähigkeit aufgrund dieses Verständnisses neue Fähigkeiten zu entwickeln: eine ineinandergreifende Matrix von Neues schaffen und einem neuen Umgehen mit neu Geschaffenem. In der Renaissance gab es das Ideal des Universalgenies, des in allen Wissenschaften und Künsten gebildeten und in all diesen Bereichen tätigen Menschen: Baumeister und Maler, Musiker und Manager. Vielleicht gehen wir in eine neue Renaissance. Diesmal, in einem reflektiert übertragenen Sinne, eine neue Wiederbesinnung auf die Antike, dieser Epoche der Geistesgeschichte, in der das kritisch reflektierte freie Denken eine so große Bedeutung hatte.
Deshalb zum Schluss eine Lektüreempfehlung: Carlo Rovelli: Die Geburt der Wissenschaft. Anaximander und sein Erbe. Hamburg 2019. ISBN 9783498053987.